Die Bedeutung des Designs optischer Systeme variiert je nachdem, wen Sie fragen. Meiner Meinung nach ist es eher ein fortlaufender Prozess als eine einzelne Aufgabe. Bei einem Prozess handelt es sich um etwas, das man kontinuierlich durchführt, wobei man Rückmeldungen nutzt, um jede Entwicklungsstufe zu verfeinern und zu verbessern. Im Gegensatz dazu konzentriert sich eine Aufgabe auf die Entwicklung eines bestimmten Systems oder Moduls, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.
Wenn wir den Entwurfsprozess als eine Reihe von isolierten Aufgaben behandeln, verlieren wir die Vorteile des kontinuierlichen Lernens. Ein wesentlicher Vorteil eines prozessorientierten Ansatzes besteht darin, dass wir unsere Fähigkeiten zur Vorhersage der Leistung unserer Entwürfe weiterentwickeln können.
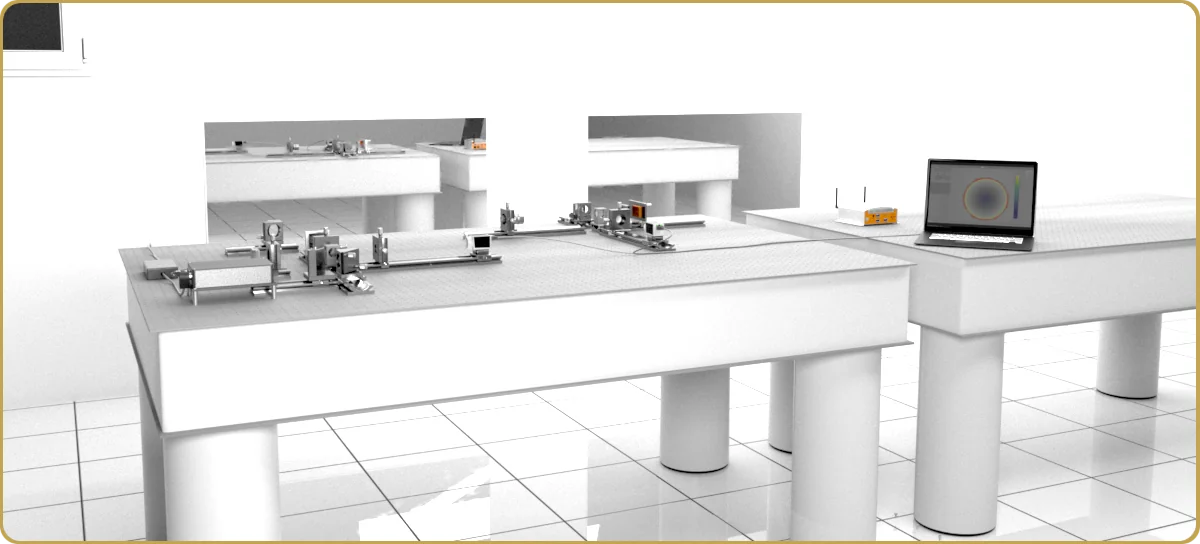
Um dies zu erreichen, können wir uns nicht nur auf die Messung der Parameter verlassen, die direkt mit den Kundenanforderungen zusammenhängen, und dabei die optische Leistung der optischen Teilsysteme außer Acht lassen. In vielen Fällen ist das optische System nur eine Komponente einer größeren Maschine. Wenn die Maschine auch nur ein einziges Mal korrekt arbeitet, ziehen wir oft den Schluss, dass alle Teile gut funktionieren. Meiner Erfahrung nach ist diese Annahme jedoch häufig falsch. Komplexe Systeme können unterdurchschnittlich funktionierende Komponenten verbergen. Nur weil eine Maschine funktioniert, heißt das nicht, dass alle Teile wie vorgesehen funktionieren.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Design optischer Systeme und dem, was oft damit verwechselt wird: dem Objektivdesign. Das Objektivdesign beginnt mit spezifischen Anforderungen wie Größe, Abbildungsart, Wellenlängenbereich, Bildwinkel, Bildgröße und optische Qualität über diese Faktoren hinweg. Im Gegensatz dazu geht es beim Systemdesign um die Festlegung dieser Parameter. Sobald diese Parameter klar sind, kann ein Raytracing-Spezialist mit Software wie Zemax/OpticStudio oder Code V hervorragende Ergebnisse liefern. Ohne diese Grundlage wird alles zum Rätselraten oder zum besten Versuch.
Woher wissen wir zum Beispiel, wie viel sphärische Aberration, Feldkrümmung oder Verzerrung akzeptabel ist, um die Kundenanforderungen zu erfüllen? Gibt es Anforderungen an die Kohärenz, entweder räumlich oder longitudinal?
Lassen Sie uns tiefer in die Mathematik eintauchen. Wie beschreiben wir die optische Leistung eines Bildgebungssystems? Ist es sinnvoll, Zernike-Polynome zu verwenden? Viele argumentieren, dass die Zernike-Menge für runde Pupillen ideal ist. Für Teleskope, Projektoren oder Kameraobjektive ist das absolut richtig. Wenn die Leistungsanforderungen jedoch nicht direkt mit der Wellenfrontvarianz zusammenhängen, ist der Zernike-Satz möglicherweise nicht die beste Wahl - auch wenn er oft bevorzugt wird oder weithin beliebt ist. Die Entscheidung über den richtigen Ansatz liegt in der Verantwortung des Optikdesigners.

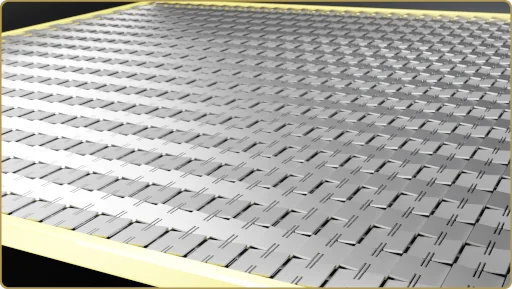
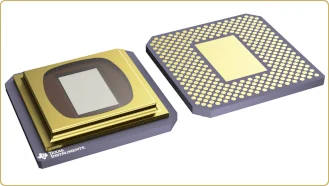
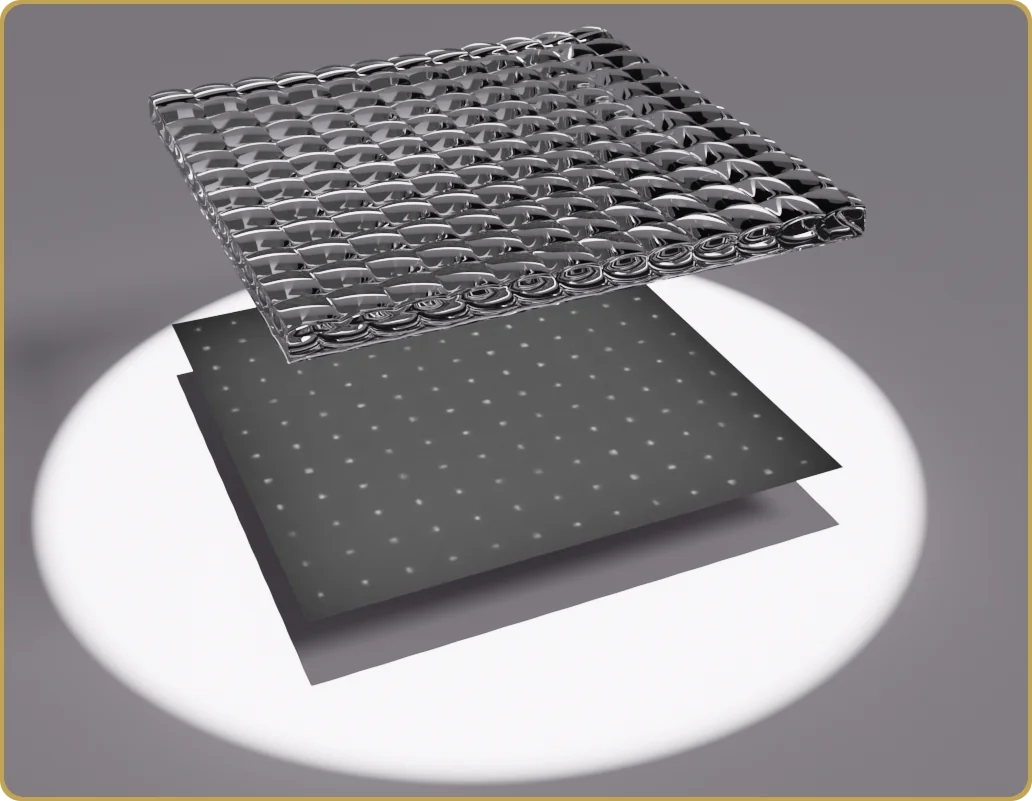

Kommentar verfassen